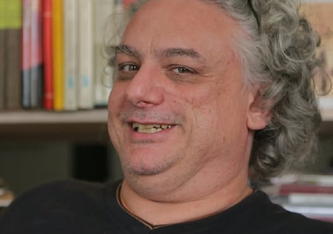
DMZ - INTERVIEW ¦ Matthias Walter
Willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Andreas Egert! Nach seinem Werdegang und der Liebe zu Aphorismen tauchen wir heute tiefer in seine Gedankenwelt ein. Andreas, lass uns weiter staunen!
Georg Christoph Lichtenberg gilt als einer der ganz Großen seines Fachs, meintest du – aber was für einen Humor hatte er eigentlich konkret? Kannst du uns dazu ein, zwei Beispiele nennen, die Lichtenbergs Witz oder auch seine geistige Schärfe exemplarisch zeigen?
Andreas Egert: Georg Christoph Lichtenberg ist zu Unrecht heute fast vergessen, seine Sudelbücher sind mit das Beste, was die deutsche Prosa und Kurzprosa hervorgebracht haben. Und nebenbei war er wohl auch noch der beste Humorist deutschsprachiger Zunge, scharfzüngig. Schlüssel zu seinem Verständnis ist sein lebenslanges Leid als Last, seine Skoliose, die ihn körperlich behinderte, seinen Geist aber nur anfeuerte. Lichtenberg war einer der wenigen deutschen Aufklärer neben Forster, den Humboldts, Kant und Lessing. Er hatte einen der ersten Lehrstühle für Physik in Göttingen, brachte den Blitzableiter in die deutschen Lande und entdeckte die Lichtenbergschen Figuren und die Influenzmaschine.
Seine Lust am physikalischen Experiment hat sich auch auf sein aphoristisches Werk übertragen. Er war wie Kant auch ein Aufklärer über die Aufklärung, wenn auch mit anderen Mitteln, er hatte eine Schwäche für die Mystiker, Jacob Böhme vor allem, er beschrieb seine Launen und Stimmungsschwankungen, schrieb aus der ganzen Fülle seines Lebens heraus, obwohl er schon das Ich als geschlossene Einheit infrage stellte. Er gilt als Begründer des deutschen Aphorismus und war auch ein geistreicher Freund des Salons, wo er bei seinen zwei England-Aufenthalten so richtig aufblühen konnte - anders als in Göttingen. Sein Humor kommt von seinem Schmerz und wird zu seinem Schwert gegen die Unbill des Schicksals.
Lichtenberg bestach immer durch seine Unabhängigkeit, so trotzte er auch Goethes Werben um eine Freundschaft, er schrieb so klug, die beste Stelle im Werther ist die, wo er (Goethe also) den Hasenfuß endlich umbringt. Als aphoristischer Kopf war Lichtenberg ein Skeptiker und Kritiker, der wusste, dass man vom Wahrsagen besser leben kann als von Wahrheit-Sagen. Er schaffte es immer wieder durch sein aphoristisches Denken neue Perspektiven aufzumachen und mit der Pointe auf den Punkt zu kommen, bei ihm war Aufklärung immer auch eine humoristische Erkenntnismöglichkeit.
Friedrich Nietzsche ist ein Meister des Aphorismus. Was schätzt du persönlich besonders an Nietzsche? Gibt es einen Aphorismus, den du als besonders herausheben würdest? Und wenn du dir erlaubst, ihn psychoanalytisch zu betrachten – welche Dynamiken, welche Konflikte, welche Wünsche würdest du in seinem Denken ausmachen?
Andreas Egert: Mit Nietzsche verbinde ich gerne seinen Königsaphorismus: Überzeugungen sind größere Feinde der Wahrheit als Lügen. Darin kann man schon sein ganzes dynamitisches Wesen lesen und ermessen, wenn Lichtenberg bei aller Vorsicht und Skepsis, die Wahrheit noch innehat, so geht sie bei Nietzsche verloren. Er ist das Tor, die Tür zur Moderne, die sich seine Ohnmacht und Verlorenheit eingesteht, die alle Ideologien, Dogmen, Normen und bürgerlichen Werte decouvriert, um ganz am Ende doch wieder zu predigen.
Wie Lichtenberg kommt auch Nietzsche aus einem christlichen Pfarrer-Elternhaus und gelangt über die Altphilologie an einen Lehrstuhl in Basel, dem er freilich bevorzugt fremd bleibt, der ihm aber eine gewisse finanzielle Absicherung bot. Nietzsche blieb als hypersensible Persönlichkeit ein Klimaflüchtling, ging nach Turin und Sils Maria, um sich selbst besser aushalten zu können. Sein Denken ist nicht immer aphoristisch, aber es ist am besten, wenn es aphoristisch ist, aber immer hält er die Spannung, die Hochspannung des Denkens in Widersprüchen nicht aus, sein Zarathustra, sein Übermensch, seine Auslesefantasien sind ein Zeugnis davon. Sein Denken war revolutionär und geistesaristokratisch, nicht zufällig haben ihn zwei italienische Kommunisten gewürdigt und wiederentdeckt. Nietzsche war auch humorvoll, wenn er so schreibt: "Singvögel: Die Anhänger eines großen Mannes pflegen sich zu blenden, um sein Lob besser singen zu können." Dabei dachte er wohl auch an sich, nichts wäre ihm verdächtiger gewesen als ein Nietzscheaner.
Der Künstler-Philosoph wollte keine Schule gründen, er wollte den freien, offenen Geist herausbilden. Und die Psychologie war seine Meisterschaft, Freud sagte mal zurecht, Nietzsche liest er nicht, der habe ihm schon zu viel vorweggenommen. Nietzsches Denken ist größer als irgendwelche biographische Wurzeln, kaum einer löst sich so radikal von seinem Los, um es in seinem amor fati zu bejahen und darüber hinaus zu wachsen. Früh schreibt er, nur als ästhetisches Phänomen ist das Leben zu rechtfertigen und folgerichtig steht sein Stil vor allen seinen Inhalten.
Du hast in unserem ersten Gespräch bereits deine Wertschätzung für die französischen Moralisten erwähnt. Würdest du konkretisieren, was du an ihnen so faszinierend findest? Geht es um ihre psychologische Tiefe, ihren Stil, ihr Menschenbild? Darum, dass sie menschliches Verhalten sehr gut beobachten können, ja sezieren?
Andreas Egert: Le style, c'est l'homme, den Satz, mit dem wir Nietzsche quasi beschlossen haben, stammt aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts, der Hochzeit der Französischen Moralistik, der Geistesepoche, wonach sich nicht nur Cioran immer wieder sehnte. Balzac behauptet mal richtig, dass die Moralisten in einem Satz mehr sagen als die Romanciers unserer Zeit in ganzen Büchern. Der Graf von Buffon sagt damit, dass der Stil den Charakter und das Wesen des Schriftstellers verrät wie nichts sonst.
Die Moral der Moralisten darf man aber keineswegs mit unserem deformierten Moralbegriff von heute missverstehen und verwechseln. Dieses dümmliche, überhebliche moralinsaure Besserwissen und Rechthaben von heute ist eher das Gegenteil von Haltung und Moral, die man in seiner intellektuellen Dürftigkeit auch noch durch überhebliche und lächerliche Ausgrenzung bestätigen und untermauern muss.
Bei der Moral der Geschichte oder der Moral der Truppe schwingt noch ein wenig vom alten vielschichtigen Moralbegriff mit, dem es auch um die Dinge und Abgründe des Lebens und den Charakter des Menschen geht, ecce homo. Nietzsche bezeichnet die Schriften der La Rochefoucauld, Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, Montesquieu, La Bruyere und Joubert als die besten und lesenswertesten Schriften überhaupt. Man kommt hier von Montaigne und Pascal und gründet auf einer skeptischen Philosophie der Neuzeit, die sich kaum von einfachen Systemen oder bornierten Fanatismen beeindrucken lassen. Immer wieder schwankt man zwischen Schreiben und Sprechen, zwischen Schreibtisch und Salon. Da wäre man gern dabei gewesen, wenn der Revolutionär Chamfort mit dem Royalisten und selbst ernannten Adligen Rivarol freundschaftlich beinahe die Klingen verbal kreuzten.
Ein Rausch an Geistesblitzen, der das bittere, späte Schicksal der beiden Protagonisten freilich nicht beeinträchtigten sollte. Man kann sich ja des Eindrucks nicht erwehren, dass die beste Zeit Europas immer auch eine aphoristische Zeit war, die Unfähigkeit heute zum Aphorismus geht einher mit dem Abstieg Europas und ist auch eine Bildungskatastrophe. Man wird wahrscheinlich diese literarischen und philosophischen Schätze wieder entdecken müssen, wenn Europa wieder zu sich kommen will. Balzac klagte aber freilich noch auf hohem Niveau, wir haben noch einen Houellebecq. Die öffentliche Meinung ist heute die schlechteste aller Meinungen, dieses Zitat von Nicolas Chamfort habe ich nicht zufällig meinen fehlfarbenfrohen Aphorismen vorangestellt, aktueller denn je, möchte man sagen.
Der Aphorismus verdichtet, er trifft – aber unterschlägt er nicht auch? Kann diese Form, so reich sie an Andeutungen ist (das Weiterdenken anregen), auch eine Art des Auslassens sein? Mit anderen Worten: Ist der Essay nicht reichhaltiger?
Andreas Egert: Die Auslassung macht gerade den Reichtum der Königsgattung Aphorismus. Sie ermöglicht erst die Unabhängigkeit und die Offenheit der Gattung, die einen mündigen Leser erfordert: das Verhältnis Text-Leser hängt an der Auslegung des Rezipienten, die interpretative Vielseitigkeit wird dabei vom Kindsvater kunstvoll herausgefordert, immer dem Möglichkeitsdenken verpflichtet. Dass er dieses Kunststück durch Erzeugung eines nachzitternden und manchmal nachbebenden Denkreizes auf engem Raum evoziert, ist einem Übermaß an geistigem Reichtum geschuldet.
Der Leser macht aus den Leerstellen des Textes Lehrstellen. Neben diesen Verkürzungstechniken mit Paradoxien und Metaphern gibt es aber noch einen guten Grund zum Torso-Charakter des Aphorismus. Aus dem Problem der Mitteilbarkeit und seinem Sprachskeptizismus drängt der Aphorismus derart rasant und radikal auf den Punkt und die Pointe, dass er den letztlich auch noch auslöschen will. Daraus entsteht auch das Misstrauen gegen die Veröffentlichung und die Vielschreiberei, ein Merkmal des Aphorismus ist auch das Bekenntnis zur Nachlass-Gattung. Nietzsche schreibt: Gegen die Kurzsichtigen: Meint ihr denn, es müsse Stückwerk sein, weil man es in Stücken gibt und geben muss. Nach dem Misstrauen gegen alle Worte bleiben bisweilen nur Lachen und Schweigen. Zwischen der Unsagbarkeit und der Nicht-Mitteilbarkeit wächst und stirbt daraus der Aphorismus. Dabei ist er dem Essay als versucherisch und experimentell sehr verwandt, lange Aphorismen haben bisweilen den Charakter von kurzen Essays, der Aphorismus ist immer anschlussfähig. Anschlussfähig zu Gattungen wie zum Beispiel Lyrik, Tagebuch oder Satiren. Anschlussfähig aber auch zu Denkschulen wie dem Existentialismus, der Lebensphilosophie, dem Poststrukturalismus oder der Hermeneutik. Das aphoristische Denken spielt mit all diesen Optionen auf Basis einer skeptischen Grundhaltung immer wieder aufs Neue im Sinne eines Erkenntnis-Pluralismus.
Du giltst als Skeptiker – auch, was erkenntnistheoretische Systeme angeht? Wenn du dich dennoch auf einen Philosophen aus diesem Bereich festlegen müsstest: wer wäre es? Und – da du das Aphoristische liebst – wie ließe sich diese Wahl aphoristisch pointieren?
Andreas Egert: Mal eine kurze Antwort, zu Ostern nehmen wir Blaise Pascal, den christlichen Mathematiker, der im Zweifel erst zum Glauben aufsteigt: "Es gibt eine Vernunft des Herzens, die der Verstand nicht kennt. Man erfährt es bei tausend Dingen" und "Der letzte Schritt der Vernunft ist, anzuerkennen, dass unendlich viel darüber hinaus geht.”
Das war ein spannender Ritt durch die Welt von Andreas Egert! Seine Gedanken zu Lichtenberg, Nietzsche und den Moralisten lassen uns staunen und nachdenken. Im dritten Teil graben wir noch tiefer – freuen Sie sich auf mehr geistreiche Pointen und Einblicke!
