RSS DMZ
www.dmz-news.eu Blog Feed
ABC setzt „Jimmy Kimmel Live!“ nach falschen Kommentaren zu Charlie Kirk aus (Fr, 19 Sep 2025) Jimmy Kimmel bei der Moderation von ‚Jimmy Kimmel Live!‘ – nach falschen Kommentaren über Charlie Kirk setzte ABC die Show mit sofortiger Wirkung aus.
DMZ – MEDIEN ¦ Anton Aeberhard ¦
Jimmy Kimmel bei der Moderation von ‚Jimmy Kimmel Live!‘ – nach falschen Kommentaren über Charlie Kirk setzte ABC die Show mit sofortiger Wirkung aus.
DMZ – MEDIEN ¦ Anton Aeberhard ¦ >> mehr lesen
Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen – Verfassungsexperten warnen vor kaum realisierbarem Schritt (Fri, 19 Sep 2025)
 US-Präsident Donald Trump verschärft seine Rhetorik gegen die Antifa-Bewegung und kündigt deren Einstufung als Terrororganisation an.
DMZ – POLITIK ¦ Lena Wallner ¦
US-Präsident Donald Trump verschärft seine Rhetorik gegen die Antifa-Bewegung und kündigt deren Einstufung als Terrororganisation an.
DMZ – POLITIK ¦ Lena Wallner ¦ >> mehr lesen
Moderatorin Beni Rae Harmony tritt nach Ehrung des umstrittenen Aktivisten Charlie Kirk zurück (Fri, 19 Sep 2025)
 DMZ – MEDIEN ¦ Sarah Koller ¦
DMZ – MEDIEN ¦ Sarah Koller ¦
 Fehler- und Korrekturhinweise
Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre
Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden Informationen sachlich an:
Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben.
Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche
Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge.
Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder
Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen.
Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback!
Unterstützen Sie uns jetzt!
Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder
Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen.
Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in
dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar
sind.
Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter
Schatz.
Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus
anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied
machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können.
Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die DMZ
unterstützen
Fehler- und Korrekturhinweise
Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre
Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden Informationen sachlich an:
Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben.
Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche
Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge.
Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder
Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen.
Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback!
Unterstützen Sie uns jetzt!
Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder
Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen.
Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in
dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar
sind.
Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter
Schatz.
Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus
anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied
machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können.
Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die DMZ
unterstützen
>> mehr lesen
Fox News: Vom Nachrichtenkanal zur politischen Satire – nur das Publikum hat es nicht bemerkt (Fri, 19 Sep 2025)
 DMZ – MEDIEN ¦ Anton Aeberhard ¦
DMZ – MEDIEN ¦ Anton Aeberhard ¦ >> mehr lesen
Gesellschaftliche Kosten von Long COVID und ME/CFS in Deutschland erreichen Milliardenhöhe (Fri, 19 Sep 2025)
 DMZ – MEDIZIN ¦ Lena Wallner ¦
DMZ – MEDIZIN ¦ Lena Wallner ¦ >> mehr lesen
Gender-Streit in der Schweiz: Wie viel Selbstbestimmung sollen trans Jugendliche haben? (Fri, 19 Sep 2025)
 DMZ – GESELLSCHAFT ¦ Sarah Koller
DMZ – GESELLSCHAFT ¦ Sarah Koller>> mehr lesen
Klimaschutz durch Subventionsreform: Gutachten zeigt Handlungsbedarf – Politik von Wirtschaftsministerin Reiche unter Kritik (Fri, 19 Sep 2025)
 Klimaschädliche Emissionen aus der Industrie: Subventionen und fossile Energie beeinflussen die CO₂-Bilanz Deutschlands maßgeblich.
DMZ – KLIMA ¦ Sarah Koller ¦
Klimaschädliche Emissionen aus der Industrie: Subventionen und fossile Energie beeinflussen die CO₂-Bilanz Deutschlands maßgeblich.
DMZ – KLIMA ¦ Sarah Koller ¦
>> mehr lesen
Wenn Patienten zur Kasse gebeten werden – Streecks Vorschlag bedroht Solidarität und Versorgung (Thu, 18 Sep 2025)
 DMZ – POLITIK ¦ Anton Aeberhard ¦
DMZ – POLITIK ¦ Anton Aeberhard ¦ Eine Selbstbeteiligung, selbst „moderat“, kann Menschen mit geringem Einkommen stark belasten. Für viele ist ein Arztbesuch auch ohne große Beschwerden ein wichtiges Vorsorgeinstrument. Wenn finanzielle Barrieren aufgebaut werden, besteht die Gefahr, dass notwendige medizinische Hilfe erst verspätet in Anspruch genommen wird – mit höheren Kosten für das System und verschlechterten gesundheitlichen Ergebnissen. Vage Begriffe, unklare Grenzen
Was genau ist ein „Bagatellbesuch“? Wer entscheidet, ob ein Besuch notwendig ist, und auf welcher Grundlage? Solche Definitionsschwierigkeiten bergen Konfliktpotenzial – zwischen Ärzten, Patienten und Kostenträgern. Unsichere Kriterien führen entweder zu Übervorteilung der Patienten (wenn Leistungen unrechtmäßig verweigert werden) oder zu bürokratischen Hürden. Sozialpolitische Ungerechtigkeit
Selbstbeteiligungen treffen tendenziell die Ärmsten härter als Bessergestellte. Auch bei „sozialverträglichen“ Modellen drohen Ungleichheiten: Chronisch Kranke, ältere Menschen, Menschen mit geringer Bildung oder mehreren Erkrankungen sind häufiger auf regelmäßige Leistungen angewiesen. Für diese Gruppen sind Zusatzkosten besonders problematisch. Psychologische Effekte und Verhaltensverzerrungen
Finanzielle Selbstbeteiligung kann zu Vermeidungsverhalten führen – Patienten verzichten aus Angst vor Kosten auf Leistung, die eigentlich angezeigt wäre. Praktische Umsetzung und Verwaltungsaufwand
Wer organisiert die Abgrenzung von notwendigen / unnötigen Leistungen? Wie wird geprüft, ob ein Patient vorab schon „ausreichend“ Vorsorge wahrgenommen hat? Solche Systeme sind anfällig für Missbrauch, führen zu Bürokratiekosten und können die Gesundheitssysteme belasten statt zu entlasten. Historische Erfahrungen: Praxisgebühren
Deutschland hatte bereits die Praxisgebühr – sie wurde 2005 eingeführt und 2013 wieder abgeschafft, weil sie kaum wirksam war und sozial besonders ungerecht wirkte – insbesondere für Geringverdiener. Daten zeigten, dass Arztbesuche zwar abnahmen, aber nicht nur Bagatellbesuche, sondern auch notwendige Kontakte darunter litten. Mögliche Kompromisse / bessere Alternativen: Statt pauschaler Selbstbeteiligung könnte man gezieltere Steuerung überlegen: Zum Beispiel höhere Kostenbeteiligungen nur bei klar definierten Bagatellfällen, bei übermäßiger Nutzung, oder in Form von Bonusmodellen für Prävention und gesunde Lebensführung. Soziale Ausgleichsmechanismen müssen integraler Bestandteil sein: Freibeträge, Härtefallregelungen, Nullbeteiligung bei niedriger Einkommenshöhe, chronischen Erkrankungen etc. Verbesserung der Transparenz und Aufklärung: Viele Arztbesuche könnten medizinisch unnötig sein – wenn Patienten besser informiert sind, wenn Leistungserbringer weniger Anreize für überflüssige Leistungen haben, und wenn das System evidenzbasiert gesteuert wird. Förderung der Versorgungseffizienz, etwa durch bessere Koordination, weniger Überdiagnostik, vermehrte Nutzung telemedizinischer Angebote, Patientenlotsen oder Gate-Keeper-Modelle. Streecks Forderung nach Selbstbeteiligung mag finanziell motiviert und rhetorisch verführerisch sein. Doch sie droht, den sozialen Charakter der Krankenversicherung zu untergraben, zur Zwei-Klassen-Medizin zu führen und gerade Menschen mit geringem Einkommen oder besonderen gesundheitlichen Belastungen zu benachteiligen. Ohne klare Regeln, solidarischen Ausgleich und Evidenz für Wirkung und Unbedenklichkeit ist das Konzept riskant. Sparen um jeden Preis kann sich langfristig als teurer erweisen – für Gesundheit, für Gesellschaft und für das Vertrauen in das Gesundheitssystem. Fehler- und Korrekturhinweise Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden Informationen sachlich an: Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben. Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge. Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen. Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback! Unterstützen Sie uns jetzt! Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen. Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar sind. Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter Schatz. Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können. Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Die DMZ unterstützen
>> mehr lesen
Dunja Hayali: Hasswelle nach „heute journal“-Beitrag – und das Schweigen ihres Arbeitgebers (Thu, 18 Sep 2025)
 DMZ – MEDIEN ¦ Sarah Koller ¦
DMZ – MEDIEN ¦ Sarah Koller ¦
>> mehr lesen
Kash Patel und der Epstein-Fall: Zwischen Behauptung und belegten Fakten (Thu, 18 Sep 2025)
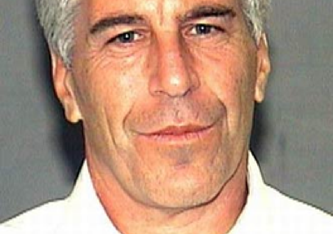 Jeffrey Epstein (Polizeifoto)
DMZ – POLITIK ¦ Lena Wallner ¦
Jeffrey Epstein (Polizeifoto)
DMZ – POLITIK ¦ Lena Wallner ¦ >> mehr lesen
Die Lektionen Immanuel Kants zur menschlichen Dummheit und der Kunst, aus Fehlern zu lernen (Thu, 18 Sep 2025)
 DMZ – BILDUNG ¦ Anton Aeberhard ¦
DMZ – BILDUNG ¦ Anton Aeberhard ¦ >> mehr lesen
Respekt – Gedanken zu einem kleinen Wort mit grosser Bedeutung (Thu, 18 Sep 2025)
 DMZ - LEBEN ¦ Patricia Jungo ¦
DMZ - LEBEN ¦ Patricia Jungo ¦ >> mehr lesen
Neue Hoffnung im Kampf gegen Herpesinfektionen (Thu, 18 Sep 2025)
 DMZ – MEDIZIN ¦ Patricia Jungo ¦
DMZ – MEDIZIN ¦ Patricia Jungo ¦ >> mehr lesen
Spitex ist mehr als Pflege – sie gibt Menschen ihr Leben zurück (Thu, 18 Sep 2025)
 DMZ – BLICKWINKEL ¦ Liselotte Hofer ¦
DMZ – BLICKWINKEL ¦ Liselotte Hofer ¦>> mehr lesen
Zur Erinnerung: Der einsame Tod des Mannes, der die Welt gerettet hatte (Thu, 18 Sep 2025)
 Oberstleutnant Stanislaw Petrow (Wikimedia Commons / (CC BY-SA 4.0) Bearbeitung: DMZ Die Mittelländsiche Zeitung)
DMZ – HISTORISCHES ¦
Von Leo Ensel
Vor drei Jahren starb, von der Öffentlichkeit unbemerkt, der russische Oberstleutnant Stanislaw Petrow
Im Herbst 1983 stand die Welt infolge eines Fehlalarms im sowjetischen Raketenabwehrzentrum unmittelbar vor einem Atomkrieg. Doch der diensthabende Offizier Stanislaw Petrow
behielt die Nerven. Am 19.05.2017 starb er einsam in seiner Plattenbauwohnung bei Moskau. Unser Autor durfte ihn noch persönlich kennenlernen.
Fast zehn Jahre hatte es gedauert, bis die Nachricht von seiner historischen Nicht-Tat allmählich in die Welt sickerte. Und dann dauerte es nochmals Jahre, bis er langsam
wenigstens einen Bruchteil der Anerkennung erhielt, die er verdient: Der ehemalige Oberstleutnant der Sowjetarmee Stanislaw Petrow hatte im Herbst 1983 durch eine einsame
mutige Entscheidung sehr wahrscheinlich einen Dritten Weltkrieg verhindert und damit das Leben von Millionen, gar Milliarden Menschen gerettet.
Die Nacht vom 25. auf den 26. September 1983
Zur Erinnerung: In der Nacht vom 25. auf den 26. September, mitten im kältesten Kalten Krieg, schrillte um 0:15 Ortszeit im sowjetischen Raketenabwehrzentrum bei Moskau die
Sirene. Das Frühwarnsystem meldete den Start einer amerikanischen Interkontinentalrakete. Dem diensthabenden Offizier Petrow blieben nur wenige Minuten zur Einschätzung der Lage.
Im Sinne der damals geltenden Abschreckungslogik – „Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter!“ – hatte die Sowjetführung weniger als eine halbe Stunde Zeit, den alles vernichtenden
Gegenschlag auszulösen.
Petrow analysierte die Situation und meldete nach zwei Minuten der Militärführung Fehlalarm infolge eines Computerfehlers. Während er noch telefonierte, zeigte das System einen
zweiten Raketenstart an, kurz darauf folgten ein dritter, vierter, fünfter Alarm. Stanislaw Petrow behielt trotz allem die Nerven und blieb bei seiner Entscheidung. Nach weiteren
18 Minuten extremster Anspannung passierte – nichts! Der diensthabende Offizier hatte Recht behalten. Es hatte sich in der Tat um einen Fehlalarm gehandelt; wie sich ein halbes
Jahr später herausstellte, infolge einer äußerst seltenen Konstellation von Sonne und Satellitensystem, noch dazu über einer US-Militärbasis. Das sowjetische Abwehrsystem hatte
diese Konfiguration als Raketenstart fehlinterpretiert.
Was geschehen wäre, wenn Petrow zu einer anderen Einschätzung gelangt und dem als äußerst argwöhnisch geltenden Parteichef Andropow den Anflug mehrerer amerikanischer
Interkontinentalraketen gemeldet hätte – und dies im Vorfeld der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Westeuropa und drei Wochen nach dem Abschuss einer südkoreanischen
Passagiermaschine über der russischen Insel Sachalin – das kann sich jeder ausrechnen, der bereit ist, Eins und Eins zusammenzuzählen. Nie hat die Welt vermutlich so unmittelbar
vor einem alles vernichtenden atomaren Weltkrieg gestanden.
Wer war dieser Mann, dem wir die Rettung unserer Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verdanken?
Ein sowjetisches Leben in kurzen Strichen skizziert: 1939 bei Wladiwostok geboren, der Vater Jagdflieger, die Familie eines Soldaten muss oft umziehen. Später wird er selbst
Berufssoldat. Für seine weltrettende Entscheidung wurde er zuerst gerüffelt, dann weder befördert noch bestraft. Den frühen Tod seiner geliebten Frau Raissa scheint er nie
verwunden zu haben. Die Journalistin Ingeborg Jacobs hat vor drei Jahren über ihn, die Zeit des Kalten Krieges und die berühmte Nacht im Herbst 1983 ein kluges einfühlsames Buch verfasst.
Ein verhinderter Friedensnobelpreisträger im Plattenbau
Als ich im Jahre 2010 zum ersten Mal von Stanislaw Petrow und den Ereignissen des 26. September 1983 erfuhr, musste ich mich erst einmal setzen. Nachdem ich endlich wieder zu mir
gekommen war, mir bewusst gemacht hatte, was da eigentlich geschehen war und was ich zusammen mit der ganzen Welt diesem Mann verdanke, schossen mir folgende Fragen durch den
Kopf:
Warum erhält dieser Mann nicht den Friedensnobelpreis? Warum steht diese Geschichte nicht in den Lesebüchern aller Kinder dieser Welt?
Als warnendes Beispiel dafür, wie weit es die Menschheit mit ihrem Wettrüsten bereits gebracht hatte. Und als ermutigendes Beispiel für menschlichen Mut und Zivilcourage.
Und:
Wie lebt dieser Stanislaw Petrow als russischer Rentner in seiner vermutlich 60 Quadratmeter großen Wohnung im Plattenbau? Hat er mehr als 200 Euro im Monat?
Und:
Wie geht es ihm? Ist er gesund? Glücklich?
Ich wusste nichts über ihn und hatte doch, ohne es erklären zu können, ein Gefühl: Dieser Mann ist nicht glücklich!
Im Mai 2013 nahm ich Kontakt mit ihm auf. Ich schickte Stanislaw Petrow einen Dankesbrief zusammen mit einer schönen Armbanduhr, auf deren Rückseite eine Dankeswidmung eingraviert
war, und Geld. Wenig später erhielt ich von ihm eine sehr freundliche Mail.
Besuch in Frjasino
Es dauerte noch drei Jahre, bis ich ihn im Sommer 2016 in Frjasino bei Moskau besuchte. Als das Taxi vor dem großen Wohnblock in der Uliza 60 let SSSR hielt, stand er schon, in
der Hand eine Stofftasche, vor dem Eingang. Er kam gerade vom Kiosk, wo er noch Mineralwasser für uns beide eingekauft hatte. Ich sah einen schmächtigen älteren Mann mit fahler
Gesichtsfarbe, schon etwas klapprig auf den Beinen, der erkennbar schlecht sah. Wie er mir später erzählte, war eine Star-Operation nicht erfolgreich verlaufen.
Der Autor und der Retter der Welt vor dessen Wohnblock im Moskauer Randgebiet. Foto: privat
Vor diesem Treffen hatte ich Angst gehabt. Ich wusste, dass seine zunehmende Bekanntheit ihm durchaus nicht immer zum Vorteil gereicht hatte. Die wenigsten seiner Besucher waren
uneigennützig gewesen, von einem dänischen Regisseur waren er und seine Geschichte wie eine Goldmine zynisch ausgebeutet worden. Er war zu recht misstrauisch.
Wir setzten uns in seine Küche und es wunderte mich nicht: Viele russische Männer, vor allem die älteren, tun sich schwer mit der Führung eines eigenen Haushalts – und das konnte
man deutlich sehen. Ich fuhr alle meine Antennen so weit wie möglich aus, ignorierte die verwahrloste Küche und schaute ihm nur in seine schönen wässrig-hellblauen Augen. Eine
Stunde nahm er sich Zeit und ich erlebte auf dem abgewetzten speckigen Küchenmobiliar aus Kunstleder einen freundlichen, klugen, sensiblen und gebildeten Mann mit einer kräftigen
dunklen Stimme.
Als ich ihn aus sentimentalen Gründen bat, mir ein Autogramm in mein Buch über Angst und atomare Aufrüstung zu schreiben, das ich
1982 im Vorfeld der NATO-Nachrüstung verfasst hatte, meinte er schmunzelnd: „Normalerweise sind es doch die Autoren, die Autogramme geben!“ Und er malte, aufgrund seiner
schlechten Augen, vorsichtig jeden Buchstaben. Als ich später mir alles genauer anschaute, staunte ich nicht schlecht: Als Datum hatte er mir den 3. Juli 1916 notiert. Der Retter
der Welt hatte sich um ganze hundert Jahre geirrt! Der Kontrast war hinreißend: Hier irrte er sich um hundert Jahre – aber in der Nacht, als es Spitz auf Knauf stand, in der es um
Sein oder Nichtsein für den gesamten Planeten ging, da hatte er schlafwandlerisch alles richtig gemacht!
Der Abschied war freundschaftlich und herzlich.
Späte Anerkennung
In den letzten zehn Jahren seines Lebens kam es dann doch noch zu einer gewissen späten Anerkennung. Er erhielt Einladungen nach New York, Westeuropa und besonders oft nach
Deutschland. Und einige Preise waren nicht nur mit Ehre verbunden, sondern zum Glück auch mit – Geld! Und doch blieb er, so scheint es mir, zugleich der einsame Mann in der
verstaubten unbenutzten Küche seiner Plattenbauwohnung, endlose 50 Kilometer vom Moskauer Stadtzentrum, vom Kreml entfernt.
Anläßlich einer Preisverleihung 2012 in Baden-Baden kam es am Ende eines Interviews, das die WELT mit ihm führte, zu folgendem bemerkenswerten Dialog:
Die Welt: Herr Petrow, sind Sie ein Held?
Stanislaw Petrow: Nein, ich bin kein Held. Ich habe einfach nur meinen Job richtig gemacht.
Die Welt: Aber Sie haben die Welt vor einem Dritten Weltkrieg bewahrt.
Stanislaw Petrow: Das war nichts Besonderes.
Man halte für einen Moment lang inne und mache sich klar, was dieser nüchterne Satz Petrows bedeutet: Er ist nichts weniger als das Understatement der Weltgeschichte!
Vor drei Jahren, am 19. Mai 2017 starb Stanislaw Petrow im Alter von 77 Jahren in Frjasino. Wie mir sein Sohn Dmitri Anfang September 2017 mitteilte, wurde er im engsten
Familienkreis beigesetzt. Es dauerte fast vier Monate, bis diese Nachricht die Welt endlich erreichte.
Hintergrund
Der Autor fuhr im April 2019 zusammen mit Karl Schumacher, einem Mann, der außerordentlich viel für Petrow getan hat, erneut nach Frjasino. Die beiden trafen sich mit den
Kindern und Enkeln Petrows in dessen nun renovierter Wohnung und besuchten mit ihnen Petrows Grab.
Dieser Text
erschien zuerst bei
RT Deutsch.
Oberstleutnant Stanislaw Petrow (Wikimedia Commons / (CC BY-SA 4.0) Bearbeitung: DMZ Die Mittelländsiche Zeitung)
DMZ – HISTORISCHES ¦
Von Leo Ensel
Vor drei Jahren starb, von der Öffentlichkeit unbemerkt, der russische Oberstleutnant Stanislaw Petrow
Im Herbst 1983 stand die Welt infolge eines Fehlalarms im sowjetischen Raketenabwehrzentrum unmittelbar vor einem Atomkrieg. Doch der diensthabende Offizier Stanislaw Petrow
behielt die Nerven. Am 19.05.2017 starb er einsam in seiner Plattenbauwohnung bei Moskau. Unser Autor durfte ihn noch persönlich kennenlernen.
Fast zehn Jahre hatte es gedauert, bis die Nachricht von seiner historischen Nicht-Tat allmählich in die Welt sickerte. Und dann dauerte es nochmals Jahre, bis er langsam
wenigstens einen Bruchteil der Anerkennung erhielt, die er verdient: Der ehemalige Oberstleutnant der Sowjetarmee Stanislaw Petrow hatte im Herbst 1983 durch eine einsame
mutige Entscheidung sehr wahrscheinlich einen Dritten Weltkrieg verhindert und damit das Leben von Millionen, gar Milliarden Menschen gerettet.
Die Nacht vom 25. auf den 26. September 1983
Zur Erinnerung: In der Nacht vom 25. auf den 26. September, mitten im kältesten Kalten Krieg, schrillte um 0:15 Ortszeit im sowjetischen Raketenabwehrzentrum bei Moskau die
Sirene. Das Frühwarnsystem meldete den Start einer amerikanischen Interkontinentalrakete. Dem diensthabenden Offizier Petrow blieben nur wenige Minuten zur Einschätzung der Lage.
Im Sinne der damals geltenden Abschreckungslogik – „Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter!“ – hatte die Sowjetführung weniger als eine halbe Stunde Zeit, den alles vernichtenden
Gegenschlag auszulösen.
Petrow analysierte die Situation und meldete nach zwei Minuten der Militärführung Fehlalarm infolge eines Computerfehlers. Während er noch telefonierte, zeigte das System einen
zweiten Raketenstart an, kurz darauf folgten ein dritter, vierter, fünfter Alarm. Stanislaw Petrow behielt trotz allem die Nerven und blieb bei seiner Entscheidung. Nach weiteren
18 Minuten extremster Anspannung passierte – nichts! Der diensthabende Offizier hatte Recht behalten. Es hatte sich in der Tat um einen Fehlalarm gehandelt; wie sich ein halbes
Jahr später herausstellte, infolge einer äußerst seltenen Konstellation von Sonne und Satellitensystem, noch dazu über einer US-Militärbasis. Das sowjetische Abwehrsystem hatte
diese Konfiguration als Raketenstart fehlinterpretiert.
Was geschehen wäre, wenn Petrow zu einer anderen Einschätzung gelangt und dem als äußerst argwöhnisch geltenden Parteichef Andropow den Anflug mehrerer amerikanischer
Interkontinentalraketen gemeldet hätte – und dies im Vorfeld der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Westeuropa und drei Wochen nach dem Abschuss einer südkoreanischen
Passagiermaschine über der russischen Insel Sachalin – das kann sich jeder ausrechnen, der bereit ist, Eins und Eins zusammenzuzählen. Nie hat die Welt vermutlich so unmittelbar
vor einem alles vernichtenden atomaren Weltkrieg gestanden.
Wer war dieser Mann, dem wir die Rettung unserer Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verdanken?
Ein sowjetisches Leben in kurzen Strichen skizziert: 1939 bei Wladiwostok geboren, der Vater Jagdflieger, die Familie eines Soldaten muss oft umziehen. Später wird er selbst
Berufssoldat. Für seine weltrettende Entscheidung wurde er zuerst gerüffelt, dann weder befördert noch bestraft. Den frühen Tod seiner geliebten Frau Raissa scheint er nie
verwunden zu haben. Die Journalistin Ingeborg Jacobs hat vor drei Jahren über ihn, die Zeit des Kalten Krieges und die berühmte Nacht im Herbst 1983 ein kluges einfühlsames Buch verfasst.
Ein verhinderter Friedensnobelpreisträger im Plattenbau
Als ich im Jahre 2010 zum ersten Mal von Stanislaw Petrow und den Ereignissen des 26. September 1983 erfuhr, musste ich mich erst einmal setzen. Nachdem ich endlich wieder zu mir
gekommen war, mir bewusst gemacht hatte, was da eigentlich geschehen war und was ich zusammen mit der ganzen Welt diesem Mann verdanke, schossen mir folgende Fragen durch den
Kopf:
Warum erhält dieser Mann nicht den Friedensnobelpreis? Warum steht diese Geschichte nicht in den Lesebüchern aller Kinder dieser Welt?
Als warnendes Beispiel dafür, wie weit es die Menschheit mit ihrem Wettrüsten bereits gebracht hatte. Und als ermutigendes Beispiel für menschlichen Mut und Zivilcourage.
Und:
Wie lebt dieser Stanislaw Petrow als russischer Rentner in seiner vermutlich 60 Quadratmeter großen Wohnung im Plattenbau? Hat er mehr als 200 Euro im Monat?
Und:
Wie geht es ihm? Ist er gesund? Glücklich?
Ich wusste nichts über ihn und hatte doch, ohne es erklären zu können, ein Gefühl: Dieser Mann ist nicht glücklich!
Im Mai 2013 nahm ich Kontakt mit ihm auf. Ich schickte Stanislaw Petrow einen Dankesbrief zusammen mit einer schönen Armbanduhr, auf deren Rückseite eine Dankeswidmung eingraviert
war, und Geld. Wenig später erhielt ich von ihm eine sehr freundliche Mail.
Besuch in Frjasino
Es dauerte noch drei Jahre, bis ich ihn im Sommer 2016 in Frjasino bei Moskau besuchte. Als das Taxi vor dem großen Wohnblock in der Uliza 60 let SSSR hielt, stand er schon, in
der Hand eine Stofftasche, vor dem Eingang. Er kam gerade vom Kiosk, wo er noch Mineralwasser für uns beide eingekauft hatte. Ich sah einen schmächtigen älteren Mann mit fahler
Gesichtsfarbe, schon etwas klapprig auf den Beinen, der erkennbar schlecht sah. Wie er mir später erzählte, war eine Star-Operation nicht erfolgreich verlaufen.
Der Autor und der Retter der Welt vor dessen Wohnblock im Moskauer Randgebiet. Foto: privat
Vor diesem Treffen hatte ich Angst gehabt. Ich wusste, dass seine zunehmende Bekanntheit ihm durchaus nicht immer zum Vorteil gereicht hatte. Die wenigsten seiner Besucher waren
uneigennützig gewesen, von einem dänischen Regisseur waren er und seine Geschichte wie eine Goldmine zynisch ausgebeutet worden. Er war zu recht misstrauisch.
Wir setzten uns in seine Küche und es wunderte mich nicht: Viele russische Männer, vor allem die älteren, tun sich schwer mit der Führung eines eigenen Haushalts – und das konnte
man deutlich sehen. Ich fuhr alle meine Antennen so weit wie möglich aus, ignorierte die verwahrloste Küche und schaute ihm nur in seine schönen wässrig-hellblauen Augen. Eine
Stunde nahm er sich Zeit und ich erlebte auf dem abgewetzten speckigen Küchenmobiliar aus Kunstleder einen freundlichen, klugen, sensiblen und gebildeten Mann mit einer kräftigen
dunklen Stimme.
Als ich ihn aus sentimentalen Gründen bat, mir ein Autogramm in mein Buch über Angst und atomare Aufrüstung zu schreiben, das ich
1982 im Vorfeld der NATO-Nachrüstung verfasst hatte, meinte er schmunzelnd: „Normalerweise sind es doch die Autoren, die Autogramme geben!“ Und er malte, aufgrund seiner
schlechten Augen, vorsichtig jeden Buchstaben. Als ich später mir alles genauer anschaute, staunte ich nicht schlecht: Als Datum hatte er mir den 3. Juli 1916 notiert. Der Retter
der Welt hatte sich um ganze hundert Jahre geirrt! Der Kontrast war hinreißend: Hier irrte er sich um hundert Jahre – aber in der Nacht, als es Spitz auf Knauf stand, in der es um
Sein oder Nichtsein für den gesamten Planeten ging, da hatte er schlafwandlerisch alles richtig gemacht!
Der Abschied war freundschaftlich und herzlich.
Späte Anerkennung
In den letzten zehn Jahren seines Lebens kam es dann doch noch zu einer gewissen späten Anerkennung. Er erhielt Einladungen nach New York, Westeuropa und besonders oft nach
Deutschland. Und einige Preise waren nicht nur mit Ehre verbunden, sondern zum Glück auch mit – Geld! Und doch blieb er, so scheint es mir, zugleich der einsame Mann in der
verstaubten unbenutzten Küche seiner Plattenbauwohnung, endlose 50 Kilometer vom Moskauer Stadtzentrum, vom Kreml entfernt.
Anläßlich einer Preisverleihung 2012 in Baden-Baden kam es am Ende eines Interviews, das die WELT mit ihm führte, zu folgendem bemerkenswerten Dialog:
Die Welt: Herr Petrow, sind Sie ein Held?
Stanislaw Petrow: Nein, ich bin kein Held. Ich habe einfach nur meinen Job richtig gemacht.
Die Welt: Aber Sie haben die Welt vor einem Dritten Weltkrieg bewahrt.
Stanislaw Petrow: Das war nichts Besonderes.
Man halte für einen Moment lang inne und mache sich klar, was dieser nüchterne Satz Petrows bedeutet: Er ist nichts weniger als das Understatement der Weltgeschichte!
Vor drei Jahren, am 19. Mai 2017 starb Stanislaw Petrow im Alter von 77 Jahren in Frjasino. Wie mir sein Sohn Dmitri Anfang September 2017 mitteilte, wurde er im engsten
Familienkreis beigesetzt. Es dauerte fast vier Monate, bis diese Nachricht die Welt endlich erreichte.
Hintergrund
Der Autor fuhr im April 2019 zusammen mit Karl Schumacher, einem Mann, der außerordentlich viel für Petrow getan hat, erneut nach Frjasino. Die beiden trafen sich mit den
Kindern und Enkeln Petrows in dessen nun renovierter Wohnung und besuchten mit ihnen Petrows Grab.
Dieser Text
erschien zuerst bei
RT Deutsch.
 Der Autor und der Retter der Welt vor dessen Wohnblock im Moskauer Randgebiet. Foto: privat
Der Autor und der Retter der Welt vor dessen Wohnblock im Moskauer Randgebiet. Foto: privat
>> mehr lesen
Schweiz macht unsichtbare Ausbeutung sichtbar – Start der siebten Aktionswochen gegen Menschenhandel (Wed, 17 Sep 2025)
 DMZ – JUSTIZ ¦ MM ¦ AA ¦
DMZ – JUSTIZ ¦ MM ¦ AA ¦ >> mehr lesen
Zur Erinnerung: Internationale Deklaration fordert Aufbruch in der Forschung zu ME/CFS und Long COVID (Wed, 17 Sep 2025)
 DMZ – GESUNDHEIT ¦ Sarah Koller
DMZ – GESUNDHEIT ¦ Sarah Koller>> mehr lesen
AT: „Wehrhafte Demokratie – Wehrhafte Frauen“: Künstlerinnen setzten Zeichen im Parlament (Wed, 17 Sep 2025)
 (c) Parlamentsdirektion/Johannes Zinner
DMZ – POLITIK ¦ Lena Wallner ¦
(c) Parlamentsdirektion/Johannes Zinner
DMZ – POLITIK ¦ Lena Wallner ¦ >> mehr lesen
Ausflugstipps

In unregelmässigen Abständen präsentieren die Macherinnen und Macher der Mittelländischen ihre ganz persönlichen Auflugsstipps.
Rezepte

Wir präsentieren wichtige Tipps und tolle Rezepte. Lassen Sie sich von unseren leckeren Rezepten zum Nachkochen inspirieren.
Persönlich - Interviews

"Persönlich - die anderen Fragen" so heisst unsere Rubrik mit den spannendsten Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern.
